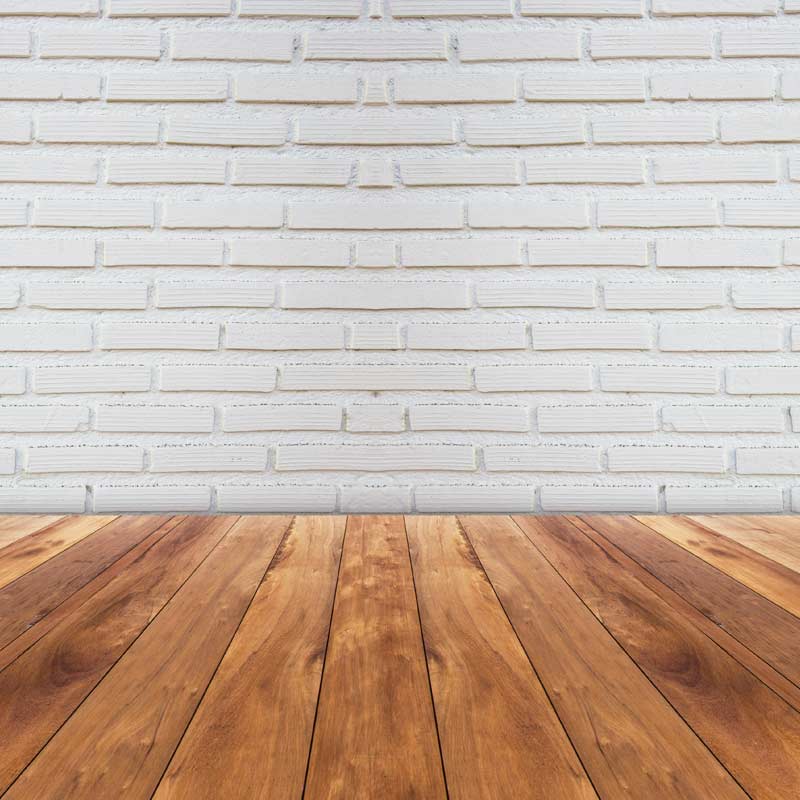Wie lange hat man nach der Kündigung Zeit, um eine Kündigungsschutzklage einzureichen?
Nach § 4 S. 1 KSchG kann der Arbeitnehmer innerhalb von drei Wochen nach der Kündigung eine Kündigungsschutzklage einreichen. Nach dem Ablauf dieser Klagefrist ist die Kündigung gemäß § 7 KSchG als endgültig rechtswirksam anzusehen.
Gibt es Ausnahmen von der dreiwöchigen Klagefrist?
- In § 5 KSchG sind einige wenige Ausnahmen aufgeführt. Die Norm greift beispielsweise, wenn der Arbeitnehmer plötzlich schwer erkrankt und die Klage aus diesem Grund nicht einreichen kann.
- Der Arbeitnehmer muss den Antrag auf nachträgliche Zulassung der Kündigungsschutzklage innerhalb von zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses, das der rechtzeitigen Klageerhebung entgegenstand, stellen. Das Gesetz gibt darüber hinaus eine Höchstfrist von sechs Monaten vor. Nach Ablauf der sechs Monate ist das Einreichen der Klage in der Regel nicht mehr möglich.
Wie wirken sich Gespräche zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf die Frist aus?
In der Praxis folgen auf eine Kündigung regelmäßig Gespräche zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer, in denen über eine mögliche Fortführung des Arbeitsverhältnisses oder die Höhe einer Abfindung gesprochen wird. Dies kann den Arbeitnehmer in eine schwierige Lage bringen, denn während der Gespräche verstreicht die Frist zur Klageeinreichung.
In dem Fall vor dem LAG Berlin-Brandenburg reichte der Arbeitgeber zum 7.11.2011 die Kündigung zum Februar 2012 ein. Der Arbeitnehmerin wurde eine Abfindung in Aussicht gestellt, soweit keine Kündigungsschutzklage einreicht würde. Drei Tage vor Ablauf der Klagefrist am 25.11.2011 (Freitag) informierte die Arbeitnehmerin den Geschäftsführer von ihrer Schwangerschaft, die am Tage zuvor erstmals festgestellt worden war. Der Arbeitgeber kündigte daraufhin an, sich mit seinem Anwalt besprechen zu wollen und versprach weitere Gespräche. Nach Ablauf der Klagefrist aus § 7 KSchG wurde der Arbeitnehmerin jedoch mitgeteilt, dass man an der wirksamen Kündigung festhalten wolle. Die Arbeitnehmerin reichte am 16.01.2012 eine nachträgliche Kündigungsschutzklage ein (LAG Berlin-Brandenburg 02.11.2012 – 6 Sa 1754/12).
- Solange keine rechtsgültige Einigung über das Fortbestehen des Arbeitsverhältnisses vorliegt, handelt der Arbeitnehmer auf eigenes Risiko, wenn er sich auf Verhandlungen mit dem Arbeitgeber einlässt, ohne dass vorsorglich eine Kündigungsschutzklage eingereicht wurde (LAG Berlin-Brandenburg 02.11.2012 – 6 Sa 1754/12).
- Durch die Äußerung des Arbeitgebers am letzten Tag der Klagefrist, man werde am nächsten Tag reden, wird der Arbeitnehmer nicht arglistig von einer vorsorglichen Klagerhebung abgehalten (LAG Berlin-Brandenburg 02.11.2012 – 6 Sa 1754/12).
- Die schwangere Arbeitnehmerin hätte sich im Rahmen der Kündigungsschutzklage auf § 9 Abs. 1 MuSchG berufen können, hierfür hätte sie die Klage im Rahmen der dreiwöchigen Frist einreichen müssen.
- Wer nach Ablauf der Kündigungsfrist von einer Schwangerschaft erfährt, kann sich auf § 5 Abs. 1 KSchG berufen. Im vorliegenden Fall hat die Arbeitnehmerin jedoch einige Tage vor dem Fristablauf von der Schwangerschaft erfahren (LAG Berlin-Brandenburg 02.11.2012 – 6 Sa 1754/12).
- In Fällen, in denen die Arbeitgeberin wenige Tage vor dem Ende der Klagefrist von der Schwangerschaft erfährt, tendieren Gerichte dazu, drei Werktage Überdenkzeit einzuräumen. Im konkreten Fall erfuhr die Arbeitnehmerin von der Schwangerschaft an einem Freitag (25.11) und am Montag (28.11) lief die Klagefrist ab. Somit hatte sie drei Werktage Zeit, um sich für oder gegen eine Klage zu entscheiden (LAG Berlin-Brandenburg 02.11.2012 – 6 Sa 1754/12).
In welchen Fällen ist eine nachträgliche Klageeinreichung denkbar?
Das LAG Berlin Brandenburg hat in einem anderen Fall entschieden, dass die nachträgliche Klageeinreichung möglich ist. Die Arbeitnehmerin hatte eine Klage sechs Tage nachdem die Kündigung bei ihr eingegangen ist, vor dem zuständigen Gericht eingereicht. Allerdings enthielt das Dokument eine Containersignatur und wurde über das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach des Arbeitsgerichtes eingereicht. Die Containersignatur entsprach jedoch nicht der Form, die für eine Kündigungsschutzklage vorausgesetzt wird. Bis sich die Unzulässigkeit der Klage im Laufe des Verfahrens herausstellte, war die Frist aus § 7 KSchG bereits verstrichen. Die Arbeitnehmerin wollte deswegen vor Gericht einen Antrag auf die nachträgliche Zulassung der neueingereichten Klage durchsetzen (LAG Berlin-Brandenburg 07.11.2019 – 5 Sa 134/19).
- Eine nachträgliche Zulassung der Klage ist immer dann möglich, wenn das zuständige Gericht zu erkennen gibt, dass es zu der Sache trotzdem entscheiden möchte. Dies war laut dem LAG in dem konkreten Fall gegeben, da das zuständige Arbeitsgericht sich trotz der seit sechs Monaten verstrichen Frist mit der Angelegenheit beschäftigt und auch letztendlich darüber entschieden hat (LAG Berlin-Brandenburg 07.11.2019 – 5 Sa 134/19).
- Das Gericht hat dem Kläger einen bereits bei Klageeingang erkennbaren Mangel erst nach Ablauf der Sechs-Monats-Frist entgegengehalten und vorher eindeutig zu erkennen gegeben, dass es die Klage für mangelfrei hält. Wenn die nachträgliche Zulassung der Kündigungsschutzklage in diesen Konstellationen ausgeschlossen werde, würde dies dem Gebot eines fairen Verfahrens widersprechen (LAG Berlin-Brandenburg 07.11.2019 – 5 Sa 134/19).
Welchen Sinn und Zweck erfüllt § 87 Abs.1 Nr.6 BetrVG?
Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates aus § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG soll das Sammeln von personen- und leistungsbezogenen Informationen über die Arbeitgeber eingrenzen. Das Persönlichkeitsrecht der Arbeitnehmer soll geschützt werden.
- „Überwachung“ im Sinne des Mitbestimmungsrechts ist ein Vorgang, durch den Informationen über das Verhalten oder die Leistung von Arbeitnehmern erhoben und regelmäßig aufgezeichnet werden, um sie auch späterer Wahrnehmung zugänglich zu machen (BAG 2016 – 1 ABR 7/15).
Ist die Facebook Präsenz eines Unternehmens eine technische Einrichtung nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG?
Ja! Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass Facebookseiten immer dann unter § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG fallen, wenn sich Beiträge auf der Seite auf bestimmte Mitarbeiter beziehen (BAG 2016 – 1 ABR 7/15).
Ist der Twitter Account eines Unternehmens eine technische Einrichtung nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG?
Das Bundesarbeitsgericht hat noch kein Urteil zu dem Mitbestimmungsrecht für Twitter gefällt.
Das Landesarbeitsgericht Hamburg hat in seinem Urteil auch Twitter als Fall des § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG eingestuft.
- Bei Twitter bestehe die Möglichkeit, dass Nutzer den Unternehmensaccount in ihren Tweets (Beiträgen) erwähnen und auf dessen Beiträge antworten. Darin könnten sich Nutzer über konkrete Mitarbeiter des Unternehmens äußern.
- Da sich die „Antwort“-Funktion nicht separat deaktivieren lasse, sei die Twitter-Nutzung insgesamt mitbestimmungspflichtig (LAG Hamburg 2018- 2 TaBV 5/18).
Im vorliegenden Fall hat das BAG das Unternehmen verpflichtet, die Aktivierung der Nutzerbeiträge auf Facebook zu unterlassen, bis der Betriebsrat zugestimmt hat (BAG 2016 – 1 ABR 7/15).